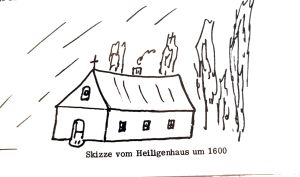Das Heiligenhaus und das Siechhaus
Nordöstlich vom Mensfelder Kopf erhebt sich eine kleine Anhöhe, die etwa 30 Meter tiefer liegt als der Mensfelder Kopf, der den Namen Hornel trägt. Unterhalb des Hornelberges, in östlicher Richtung, soll bis zum dreißigjährigen Krieg (1618-1648) ein Häuschen gestanden haben, das von zwei Einsiedlern (Mönchen) bewohnt wurde. Das Häuschen war aus Hornelsteinen gebaut. Es hatte ein spitzes Strohdach. Innen waren zwei Räume, die von drei kleinen Fenstern Licht bekamen. Die Eingangstür war aus dicken Eichenbohlen und in der Mitte geteilt. Oben auf dem Dachfirst der Giebelspitze war ein Kreuz aus Birkenholz angebracht. In der Spitze der hohen Giebelwand hing in einer fensterartigen Luke, ein Glöcklein. Jeden Morgen und Abend läutete das Glöcklein, um die Menschen zu ermahnen, ihr Tagwerk mit Gott zu beginnen und zu vollenden. Außerdem läutete es auch bei drohenden Überfällen, damit sich die Menschen auf dem Feld und auf der unterhalb vorbeiführenden Landstraße nach Diez noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.
Nun zurück zu den Mönchen. Woher sie kamen, weiß man nicht. Man nimmt an, dass sie vorher in Limburg waren und von dort geschickt wurden, um die Aussätzigen im Siechhaus das im Weiderfeld stand, (oberhalb des heutigen Linterer Siechgraben) zu pflegen. So einfach sie sich kleideten, war auch ihre Wohnung eingerichtet. Über ihrer schlichten Kleidung trugen sie eine braune Kutte, die mit einer dicken Schnur zusammengehalten wurde. Ihr Schuhwerk bestand aus derben Sandalen. Ihre Wohnung, war nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Im Vorderraum standen auf einem Wandbrett zwei nussbraune Kochtöpfe und zwei Holzteller, darunter hingen zwei zinnerne Henkelbecher. Außerdem waren in dem Raum ein schwerer Eichentisch, einer Lehnebank und zwei Schemeln. Im hinteren Raum hatten die Mönche als Ruhestätte ein Strohlager. Als einziger Schmuck zierte ein schlichtes Holzkreuz die Wand. In einer zweiteiligen Truhe, hatten sie je zur Hälfte ihre aus Wolle und Leinen gewebten Kleider, ein Gebetbuch und Kräuterbuch sowie ihre Heilmittel, die aus Tee, Säften und Heilöl bestanden.
Die Kranken, die von Mensfelden und Linter kamen, verblieben im Siechhaus und wurden abwechselnd von den Mönchen betreut. War ihre Heilmethode auch ziemlich einfach und primitiv, so konnten sie doch manchen leidgeprüften Menschen Linderung verschaffen und oftmals sogar die Heilung schenken. Die Heilpflanzen sammelten sie am Abhang des Hornelberges, die dort reichlich wuchsen.
Für die Ernährung der Kranken im Siechhaus sorgten meistens deren Angehörige, auch gab es andere Wohltäter, die Kleidung und Nahrung spendeten. Die beiden Mönche ernährten sich von den gesammelten Früchten des Feldes. Für ihre Krankenpflege bekamen sie außerdem Lebensmittel in Form von Brot, Mehl und Fett in ihre Klause gebracht.
Sie führten ein gottgefälliges Leben, denn ihr Tagewerk bestand in Gebet und opferbereiter Nächstenliebe.
So erfüllten sie lange Jahre ihre Pflicht, bis dann der dreißigjährige Krieg tobte und unzähligen Leid, Verwüstung und Seuchen ins Land brachte. Auch die Mönche waren bald am Ende ihrer Kräfte, denn nicht allein die Aussätzigen füllten das Siechhaus sondern auch die Pestkranken brachte man zu ihnen. Zu dem furchtbaren Leiden kam noch der Hunger. In aufopfernder Liebe sorgten die Einsiedler Tag und Nacht für ihre Kranken und teilten den letzten Bissen mit ihnen.
Das einzige, was sie noch erquickte, war das Heilwasser (Mineralwasser), welches sie für sich und die Kranken in schweren Kannen von dem Heilbrunnen, der zwischen dem Pilgerhaus und dem Siechhaus entsprang, (am alten Diezerweg) heranschleppten. Fast alle Kranken starben dahin. Die letzten kamen in den Flammen um, als eine Kriegshorde das Siechhaus in Brand steckte.
Eines Tages klopfte ein schwer verwundeter Edelmann an die Tür ihrer Klause und bat um Hilfe und Einlass. Obwohl die beiden Mönche geschwächt und vom Tode gezeichnet waren, nahmen sie ihn auf, legten ihn auf ihre Strohlager und pflegten ihn. Der Edelmann wurde wieder gesund, aber der eine Mönch starb. Als der Edelmann wieder von dannen wollte, bat ihn der letzte Kuttenträger, der auch sein Ende fühlte, ihm noch eine Bitte zu erfüllen. Er sagte: Warte noch einen Tag, dann werde ich daheim sein. Lege dann meinen Leib zu den meiner Brüder; und merke Dir das eine: In diesem heiligen Haus wohnt Gott, der auch Dir geholfen hat. Mache, ehe Du weiterziehst, ein Zeichen an die Tür, damit es nicht geschändet wird!
Der Edelmann, der neben dem Sterbenden kniete, drückte seine vom Fieber brennende Hand und gelobte ihm, seine letzte Bitte zu erfüllen. Als der nächste Tag anbrach, hatte auch der letzte Mönch seinen Geist aufgegeben. Er begrubihn neben seine Brüder, die schon oberhalb der Klause in kühler Erde ruhten. Nachdem er ein Vaterunser gesprochen hatte, kehrte er noch einmal in die leere Klause zurück, zündete das Feuer an, und ließ darin den Schürhaken erglühen. Dann brannte er mit dem immer wieder angeglühten Schürhaken die Worte Das Heiligenhaus auf die Tür, holte das kleine Holzkreuz aus der Klause und nagelte es darüber, nahm dann sein Bündel und zog von dannen. Der Name Heiligenhaus ist bis heute erhalten geblieben. Durch unsere nassauische Mundart wurden mit der Zeit die zwei i Verschluckt, so dass daraus der Name Helgenhaus entstand:
Das alte Zollhaus zwischen Mensfelden und Linter
(Eine Erzählung aus dem Heimatbuch für den Kreis Limburg von A. Leukel)
Da, wo die alte Mainzer Straße (Siegen - Limburg - Wiesbaden - Mainz, die Hühnerstraße) den Höhensattel zwischen dem Mensfelder - und Nauheimer Kopf übersteigt, steht das alte Zollhaus. Heute ist dort eine schmucke Gaststätte, doch die alten Mauerreste, die noch überall zu finden sind, berichten von längst vergangenen Zeiten. Hier war früher der Schlagbaum; Tag und Nacht wachten hier die Zollwächter der Landesherren. An dieser Stelle stießen die Grenzen von Kurtrier und Diez - Oranien zusammen. Manch armes Rößlein quälte sich mühsam durch die tiefausgefahrenen Geleise der schlechten Straße. Bedrohlich schwankte der schwerbeladene Wagen hinter ihm. Wehe, wenn ein Rad brach oder ein Wagen umkippte! Die auf den Boden gefallene Ware gehörte dem Grundherrn des Landes.
Vom Diezer Markt kommend, bewegte sich ein hochbeladener Wagen schwerfällig dem Zollhaus zu. Auf der schlechten Straße wankt er hin und her. Diezoranische Reiter kommen hinter ihm her. Sie geben acht auf etwa herabfallende Güter. Die Fuhrleute haben Zeit, sich umzusehen in der Gegend. Noch geht es durch das weite Bucherfeld, noch ist der Weg eben. Später erblicken sie auf dem sanften Hang des Mensfelder Kopfes eine große Schafherde. Auf seiner Schippe gestützt, schaute der Schäfer zu, wie sich die Pferde mühen, den unbeholfenen Wagen den nun beginnenden Hang hinaufzuziehen. laut hallten die ermunternden Zurufe der Fuhrleute durch die stille Gegend. Ein Heiligenhäuschen steht am Wege und zeugt vom frommen Sinn der Bewohner der vielen Einzelgehöfte, die in der Landschaft zerstreut liegen. Tiefe Gräben zu beiden Seiten der Straße machen eine Abweichung von dieser Straße unmöglich. Endlich nähert sich der Wagen dem Zollhaus. Inzwischen ist es Abend geworden, blutrot ist die Sonne untergegangen. Handfeste Männer lassen nun den Schlagbaum herunter. Der Wagen muss halten. Schnell wirft der Fuhrmann den erhitzten Pferden eine Decke über, er weiß, dass die Verzollung nicht so schnell vor sich geht. Zwei Öllampen verbreiten ein spärliches Licht. Peinlich genau ist die Untersuchung, weil der Wagen Marktware, die besonders begehrt ist, geladen hat. Nach einer Stunde ist es soweit, dass der Wagen in den Hof des Gasthauses gefahren wird. Die müden Pferde werden in den Stall gestellt und gefüttert. Eine ganze Reihe Wagen steht schon im Hof, und in der Gaststube herrscht reges Leben. In lebhafter Unterhaltung werden die Erlebnisse erzählt, Erfahrungen ausgetauscht. Von störrischen Pferden, von Achsenbrüchen, räuberischen Überfällen und lästigen Schlagbäumen ist die Rede und - wie man an manchen Stellen im Land die Zollwächter hintergehen kann. Später geht man zur Ruhe. - Beim ersten Hahnenschrei wird es wieder lebendig auf dem Hofe. Pferde werden gefüttert und angeschirrt, und wenn die ersten Strahlen der Morgensonne über den Nauheimer Kopf scheinen, geht die Reise weiter. Mit Hüh und Hott lautem Peitschenknallen verschwinden die Wagen auf den Wegen, die zum Rhein, nach Wiesbaden und Mainz oder nach der Lahn hinführen.
Das Mensfelder Kornweibchen
(Eine Episode aus dem Heimatbuch für den Kreis Limburg von A. Leukel)
Heinrich Völker von Mensfelden war ein kecker Bauernbub. Er wusste wohl, dass man vor der Heumachzeit nicht in die Wiesen geht, tat es aber doch!
Er wusste auch, dass man einen Halm für eine Kornpfeife nicht aus der Mitte des Ackers holt. Aber er kümmerte sich nicht darum! Eines Tages erlebte er auf dem Wege nach Nauheim etwas Seltsames:
Wieder hielt er Ausschau nach einem schönen Kornhalm, aus welchem er eine Kornpfeife machen wollte. An einem Kornfeld angekommen, sprang er mit einem Satz über den Graben, um sich einen Halm zu holen. Die Halme am Rande des Feldes waren ihm alle nicht gut genug. Also ging er mitten in den Acker hinein und zertrat die Halme rechts und links! Soeben streckte er die Hand nach einem ganz wundervollen Halm aus, da stand einmal ein winzig kleines Weiblein vor ihm. Es trug einen himmelblauen Rock und eine rote Jacke, wie sie die alten Frauen tragen, auf dem Kopfe aber ein weißes Kopftuch. Ihr Gesicht war voller Runzeln.
Ei, Heinrich, sagte das Weiblein, willst du Kornpfeifen machen?
Heinrich nickte. Komm mit mir, ich zeige dir die besten Halme! sagte es und lachte dabei. Heinrich war erst ein bisschen erschrocken. Als er aber das Weiblein so reden hörte, da lief er gern hinterdrein. Das immer mitten durch die Halme, dass es nur so rauschte. Auf einmal fielen die Blicke Heinrichs auf die Füße des flinken Weibleins, das immer vor ihm herlief. Ei, die Füße waren ja zwei kleine, blaue Flämmchen! Da kam ein großer Schrecken über den Buben. Er dachte, nur schnell fort von dem Weiblein, das meint es gewiss nicht gut mit dir! Er wandte sich um, lief vier Schritte, stolperte über einen Grenzstein, den er im hohen Korn nicht gesehen hatte, und fiel längelang zur Erde. Erst schrie er vor Schrecken, dann aber vor Schmerz, denn auf seinen Rücken prasselten Schläge nieder, wie er sie bis dahin noch nie zu spüren bekommen hatte. Als er sich endlich aufraffte, war weit und breit kein Mensch zu sehen. Der Himmel war schön blau, und die Lerchen sangen. Hätte Heinrich nicht die Striemen auf seinem Buckel greifen können, er hätte an einen Traum geglaubt. Er schlich sich durch das Korn auf die Straße und wollte eben den Graben überspringen, als er auf einmal ein feines lachen hörte. Sieh, da saß das kleine Weiblein im Straßengraben, lachte wie toll und rief: Gelt Büblein, bös Büblein, jetzt gehst du in kein Kornfeld mehr und zertrittst die schöne Brotfrucht! Büblein, bös Büblein, jetzt kennst du auch das Kornweibchen! Dann lachte das Weiblein noch einmal aus vollem Hals, an der Stelle, wo es gewesen, flackerte ein blaues Flämmchen auf.